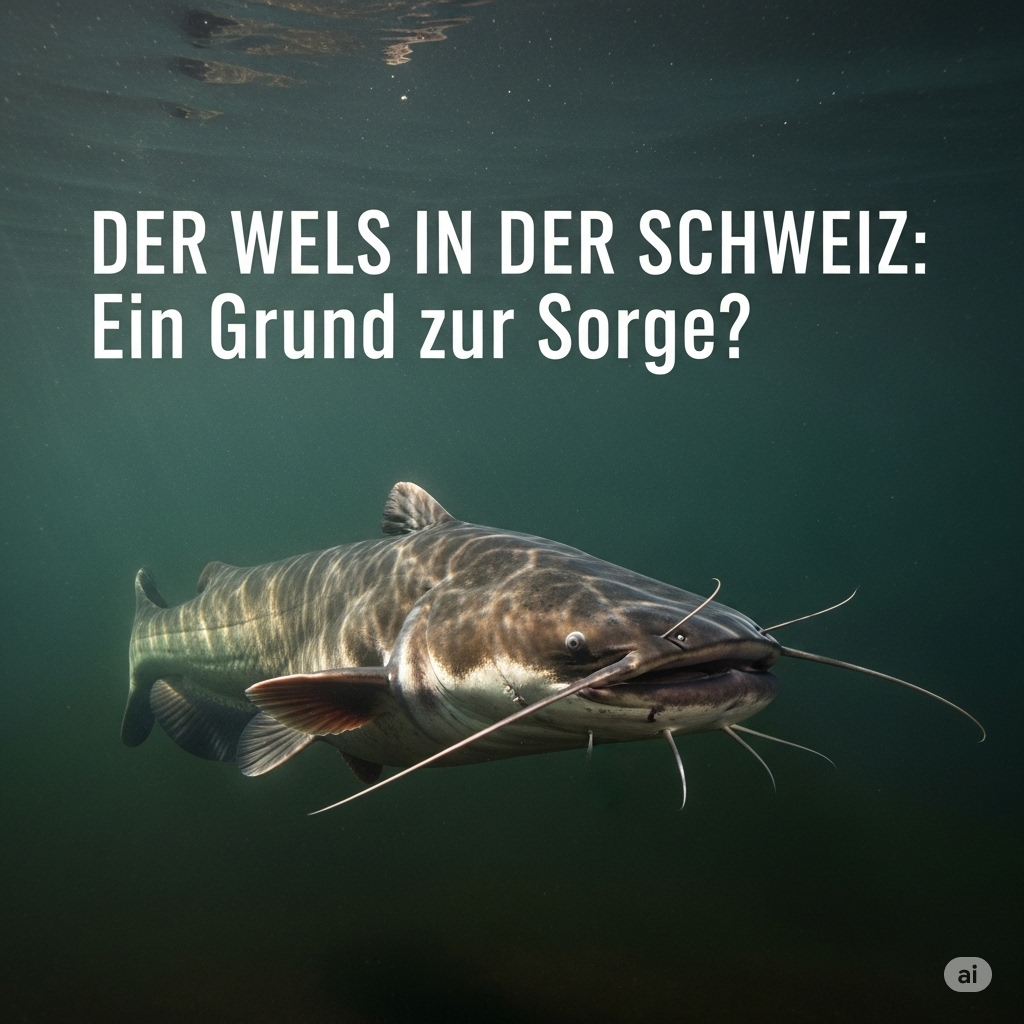Fisch des Jahres 2025
Der Zander

Der SFV wählt den Zander als Fisch des Jahres 2025, weil er als Kulturfolger und Klimagewinner die grossen Veränderungen in unseren Gewässern widerspiegelt, und weil er die Fischerei und den Fischkonsum unseres Landes in Zukunft mitgestalten wird.
Mit seinen Stachelflossen, dem goldglänzenden Schuppenpanzer und einem Maul voller spitzer Zähne wirkt er wie ein Fabelwesen. Seine grossen, schimmernden Augen wirken fremdartig und intelligent. Aus Sicht eines kleinen Fischs ist der Zander ein furchterregendes Raubtier! Ursprünglich stammt dieser aussergewöhnlich anpassungsfähige Raubfisch aus dem Osten unseres Kontinents. In den letzten 150 Jahren hat er weite Teile Westeuropas erobert. Dazu gehören auch viele Schweizer Gewässer.
Ein Raubritter erobert Europa
Der Zander ist der grösste Vertreter der Echten Barsche (Percidae). Diese Fischfamilie umfasst mehr als 200 Arten, von denen die allermeisten in Nordamerika leben. In Europa und Asien unterscheidet man aktuell 14 Arten. Einige davon, wie der Zander, das Egli und der Kaulbarsch sind weit verbreitet und häufig, während stark spezialisierte Nischenarten wie der Roi du Doubs kurz vor dem Aussterben stehen.
Ursprünglich lebte der Zander im Südosten Europas vom Kaspischen Meer über das Schwarze Meer bis in den Balkan sowie in der Donau und ihren Zuflüssen. Nach der Eiszeit eroberte der anpassungsfähige Raubfisch via die Ostsee das Baltikum und das südliche Skandinavien.
Begehrt!
Es ist aus heutiger Sicht zwar ökologisch problematisch, aber auch nachvollziehbar, dass der Zander vielerorts als attraktive Bereicherung des Fischbestands betrachtet wurde und man versuchte, ihn heimisch zu machen. Bereits im Mittelalter setzten ihn Klöster in ihren Gewässern ein, und Ende des 19. Jahrhunderts begannen auch Fischereibehörden, den attraktiven Speisefisch anzusiedeln. In den 1880er-Jahren besetzte man die ersten Zander im Hochrhein, im Bodensee und im Lago Maggiore. Weitere offizielle Ansiedlungen gab es ab 1940 in den Kantonen Luzern und Schwyz. Dasselbe geschah in Italien, in Frankreich, auf der iberischen Halbinsel und sogar in Nordafrika.
Der entscheidende «Durchbruch» für die massive Ausbreitung des Zanders in Westeuropa waren allerdings die Kanäle, die das Schwarze Meer mit Westeuropa verbinden. Der 1962 eröffnete Donau-Main-Kanal ist ein perfekter «Einwanderweg», der dem Zander und anderen Arten wie Wels, Rapfen und Schwarzmeergrundeln den Zugang in das weitläufige Einzugsgebiet des Rheins ermöglichte.
In der Schweiz hat sich der Zander etabliert. Die grössten Populationen findet man in Seen. Bekannte Beispiele sind der Murtensee, der Greyerzer- und der Schiffenensee, der Lago di Lugano, der Bodensee oder der Sihlsee. Er kommt aber auch in vielen Flüssen, Stauhaltungen und Kanälen des Mittellands vor.
Der Zander hat als Raubfisch ohne Zweifel Einfluss auf andere Fische, doch er scheint sich bisher ohne disruptive Folgen in die Schweizer Gewässerökosysteme einzugliedern.

© Daniel Luther
Der Zander ist breit akzeptiert und begehrt in der Freizeit- und Berufsfischerei. Bei Ämtern und in der Fischereibiologie gibt es hingegen Vorbehalte und Zweifel.
Feinsinnig & brutal
Der Zander ist ein Barsch wie aus dem Bilderbuch. Er hat zwei deutlich getrennte Rückenflossen, die vordere eindrucksvoll mit spitzen Stacheln gespickt! Familientypisch sind auch der flexible Panzer aus knöchernen Kammschuppen, hoch entwickelte Augen und das vorstülpbare Maul, mit dem er seine Beute einsaugt.
Ideale Bedingungen für Zander bieten grosse, fischreiche Seen und Flüsse, die deutlich über zwanzig Grad warm werden. Dort halten sie sich mit Vorliebe über hartem Grund wie Kies, Geröll oder Muschelbänken auf. Sie nutzen gern menschgemachte Strukturen wie Steinschüttungen, um ihre Beute in die Enge zu treiben.
Am erfolgreichsten jagen Zander bei wenig Licht: in der Dunkelheit, in der Tiefe oder in trübem Wasser. Unter diesen Bedingungen sind sie den meisten Beutefischen sensorisch haushoch überlegen dank lichtempfindlichen Augen, feinem Gehör und einer super-sensiblen Seitenlinie. Die Seitenlinie ist ein Sinnessystem, das feinste Druckschwankungen im Wasser wahrnimmt.
Ein Teil der Zander folgt im Freiwasser der Seen den grossen Fischschwärmen. Da drängt sich ein Vergleich mit Wölfen auf, denn die Zander jagen oft im Rudel und kreisen ihre Beute koordiniert ein. Urplötzlich greifen sie an und beissen mit ihren spitzen Zähnen wild um sich, um danach die verletzten Fische einzusammeln.
Zander sind enorm flexibel in Bezug auf Lebensraum und Nahrung. Sie leben dort, wo es am meisten zu jagen gibt und fressen, was am einfachsten zu erbeuten ist. Das sind meistens Schwarmfische, aber bei Gelegenheit auch Krebse, Würmer oder Insektenlarven.
Vorbildliche Väter
In Schweizer Gewässern pflanzen sich die Zander je nach Gewässer und Wetter von April bis Juli fort. Die abenteuerlustigsten Männchen feiern schon mit kaum 30 Zentimetern ihre erste Hochzeit, die Weibchen sind beim ersten Mal deutlich grösser. Während der Laichzeit werden die Zandermännchen auffällig dunkel.
Die Laichplätze sind sandige und kiesige Bereiche in flachem Wasser. Die Männchen befreien eifrig das künftige «Kinderzimmer» von Algen und Schlamm und posieren dann auf ihren Nestern, die bis zu einem Quadratmeter gross sein können. Wenn sie damit eine schöne Zanderin verführen, bewachen sie nach der aus Menschensicht ziemlich ruppigen und unromantischen Hochzeitsnacht die bis zu hunderttausend und mehr Eier und den daraus schlüpfenden Nachwuchs. Die Aggressivität, mit der sie jede mögliche Bedrohung ihrer Brut vertreiben, wegbeissen oder vom Nest wegschleppen, ist beeindruckend. Nur unvernünftige Angler nutzen dieses Verhalten aus. Die ungeschützten Nester werden nämlich gnadenlos von Kleinfischen und Krebsen geplündert, der Nachwuchs ist verloren.
Der Zander schätzt trübes, nährstoffreiches Wasser und hält sich gern über steinigem oder auch muschelbewachsenem Grund auf.
Kulturfolger & Klimagewinner
Was ist Erfolg? In der Natur ist die Antwort brutal klar: Wer überlebt und sich fortpflanzt. Der Zander ist in vielen Schweizer Gewässern erfolgreich und breitet sich aus, weil er besser für die aktuellen Rahmenbedingungen gerüstet ist als viele Arten, die hier über Jahrtausende heimisch waren.
Was macht den Zander anders?
- Er hat eine ungewöhnlich grosse Temperaturtoleranz. Sein Stoffwechsel läuft auf Hochtouren zwischen 10 und 30 Grad.
- Er ist nicht territorial wie Forelle oder Hecht, die für ihr Wohlbefinden viele Verstecke und Strukturen brauchen. Er kann sich zur Not auch mit monotonen Kanälen und Stauseen arrangieren.
- Er jagt erfolgreich in trübem Wasser, wie es heute durch den Einfluss des Menschen viel häufiger geworden ist.
- Er ist relativ flexibel bei den Ansprüchen an seine Laichplätze und muss dafür keine weiten Wanderungen unternehmen.
- Er verbessert durch aktive Brutpflege die Überlebenschancen seines Nachwuchses.
Doch selbst ein ökologisch robuster Kulturfolger wie der Zander ist keine unerschöpfliche Ressource! Der fischereiliche Druck in vielen Schweizer Seen ist so hoch, dass die Bestände weit weg sind von ihrem natürlichen Potenzial. Der SFV unterstützt deshalb Massnahmen, mit denen die Fortpflanzung des Zanders gesichert und die Nutzung der Bestände nachhaltiger reguliert wird.
Voll im Trend
Der Zander gehört zu den beliebtesten Speisefischen Europas. Seine weissen und grätenfreien Filets sind als goldbraune Knusperli oder gedünstet auf Gemüse eine begehrte Delikatesse – bis hinauf in die Sphären der Sterneküche.
Das klingt nach einer willkommenen Chance für die von vielen Faktoren gebeutelten Profis an unseren Seen. Doch der Zanderfang der Schweizer Berufsfischerei liegt bei maximal etwa zehn Tonnen pro Saison. Damit lässt sich nur ein Bruchteil der Nachfrage befriedigen.
Diese Marktnische nutzen mittlerweile mehrere Aquakulturunternehmen wie Basis 57 und AlpenZander. Sie haben die heimische Zanderernte auf mehrere hundert Tonnen erhöht. Selbst diese mehreren hunderttausend Fische können den gewaltigen Appetit auf die begehrten Filets nicht stillen. Aktuell werden deshalb jährlich mehrere tausend Tonnen Zander aus Osteuropa und Skandinavien importiert.
Die Prognose ist nicht gewagt: Die stark wachsende Nachfrage nach hochwertigem regionalem Frischfisch wird den Aquakultur-Boom in der Schweiz weiter anheizen, und der Zander wird dabei eine wichtige Rolle spielen.